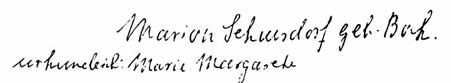Aus ihrer Ansprache beim Enkeltreffen in Berlin - Friedrichshagen am 1. Juli 1989 zur Würdigung der Großeltern Wilhelm und Marie Bock. Beide: ihrer Zeit voraus, beide Pfadfinder, einsame Wegbereiter für künftige Generationen. Heute ist es selbstverständlich, daß junge begabte Leute aus sozialschwachen Familien unterstützt und gefördert werden. Ihre Schicksale zu beschreiben, wäre ein hochaktueller Stoff für ein Buch. - Ich bin leider zu alt! Der Großvater Wilhelm Bock: "Waldbauernbub" in Hundsdorf bei Bad Wildungen, Nachkömmling in einem alten Bauerngeschlecht, trotzt ohne äußere Nötigung seinem Vater mit 12 Jahren die Erlaubnis ab, das Gymnasium in Corbach zu besuchen (Entfernung ca. 25 km, damals viel größer als heute, er muß dort wohnen.) Jetzt erst lernt er Armut und mancherlei Demütigung kennen, muß mit Zehnjährigen in eine Klasse gehen, weil ihm die Sprachen Latein und Französisch fehlen. Von Heimweh überwältigt, packt er eines Tages sein Bündel und macht sich, natürlich zu Fuß, auf den Heimweg. Unterwegs wird Ihm klar, daß er dann keine Chance mehr hat, sein Ziel zu erreichen. Er hat es selbst in seinen "Tagebüchern" als alter Mann beschrieben und Ihr könnt es nachlesen, wenn Ihr diese Hefte mal in die Hand bekommt (Schulhefte, schwer zu lesen) - Er kehrt um, und nun findet er Hilfe. Nach dem Tode des Vaters - fast mittellos - muß er mehrfach das Studium unterbrechen, um als Hauslehrer Geld zu verdienen und wird nach dem Examen in Greifswald schließlich als Assenaor nach Königsberg geschickt. Man hielt sie schon für fest verlobt mit einem Königsberger Kaufmannssohn - da löste sie die Verlobung und entschloß sich, die Gymnasial-Kurse zu besuchen, die damals in Königsberg eröffnet wurden - sehr zum Ärger ihrer Mutter - "Nun kriegst vollends keinen Mann" sagte sie. - Inzwischen war mein Großvater gestorben. Er hatte im Testament verfügt, daß die Firma, "Großhandel in Ziegeln", verkauft werden sollte, aber die Söhne und auch ihre Berater, übergingen diesen Wunsch. Die Konjuktur änderte sich und drei Jahre nach dem Tode, des hochangesehenen Kaufmanns Georg-Friedrich Lemke, machte die Firma Bankrott. Das Vermögen ging verloren, und nun mußten sich die 4 Söhne und die 3 Töchter, zusammen mit der Mutter, an ein sehr eingeschränktes Leben gewöhnen. Meine Mutter merkte das zunächst kaum, sie war glücklich, weil sie nun lernen konnte; sie lernte Latein und Mathematik, Griechisch, Deutsch und andere Sprachen, und machte ihr Abitur, begann auch noch das Studium der Philosophie und alter Sprachen, schon sehr ungewöhnlich für eine junge Dame der Gesellschaft. Indessen hatte Wilhelm Bock nicht aufgehört, um sie zu werben, am 1. April 1904 gab sie ihm ihr Jawort. Er wurde Oberlehrer am Gymnasium in Tilsit und 1905 heirateten sie. Wilhelm war 30, Marie 25. Jahre alt. Daß diese Ehe zwischen zwei so ausgeprägten Persönlichkeiten Schwierigkeiten mit sich brachte, wird Jeder verstehen. Ihre Ziele waren dieselben, aber. ihre Charaktere sehr verschieden. Dazu kam die materielle Enge, an die sich meine Mutter schwer gewöhnen konnte. - Eine kleine Episode aus der jungen Ehe möchte ich hier wiedergeben, die meine Mutter mir erzählt hat, als ich noch sehr jung war, wahrscheinlich noch im Märchenalter. Wie ein Märchen habe Ich sie aufgenommen und wie bei der Geschichte von "Rotkäppchen und dem Wolf" packte mich die Angst, aber meine Mutter lachte dabei - sie lachte über sich selbst - das konnte sie - und so half sie mir hinweg über die Bedrückung und ließ mich auf einen guten Ausgang hoffen. "Ich räumte unsere neue Wohnung in Tilsit ein und dabei fielen mir ein paar derbe Lederstiefel, nicht sehr sauber, in die Hände. Ich wußte nichts damit anzufangen, meine Brüder hatten nur Lackschuhe getragen. Die Sorgen wurden nicht kleiner, als die Familie größer wurde. Es war damals keine Kleinigkeitit, von einem Gehalt 5 Kinder aufzuziehen und auszubilden. Der Vater gab seine geliebte Jagd auf und die Mutter trug nie wieder so elegante Kleider, wie ich sie als Kind an ihr bewundert hatte. Es war war mir sogar etwas peinlich, daß sie immer nur Rock und Bluse trug und nie wieder einen Hut oder eine andere Kopfbedeckung, aber sie schien nichts zu vermissen. Sie war glücklich, weil sie, als wir nach Königsberg kamen, ihr Studium, so ganz nebenbei, wieder aufnehmen konnte, und als die Inflation viele Menschen um ihr Vermögen brachte, konnte sie mit gutem Gewissen ihren Doktor "für ein Butterbrot" machen, da die Gebührenordnung mit der schnellen Geldentwertung nicht mitkam. Damals machten ihre Studiengefährten einen Vers auf sie, in dem es hieß: Obwohl wir uns in vieler Hinsicht einschränken mußten, haben wir Kinder nie das Gefühl gehabt, arme Leute zu sein. Da waren die vielen Bücher an den Wänden, die wir hin und wieder abstauben mußten. Da waren die Gespräche der Eltern, bei denen wir freilich nur zuhören konnten; da waren unsere eigenen geschwisterlichen Gespräche. Da waren Spaziergänge mit dem Vater oder mit der Mutter, bei denen es gleichsam spielend immer etwas zu lernen gab. Wir waren alle nicht musikalisch, aber trotzdem wurde bei uns viel gesungen, vor allem Volkslieder. Unser Vater hatte eine gute Stimme, die mich sehr anrührte. Er sang viele Lieder, die er aus dem Kommersbuch kannte. Noch heute höre ich diese Stimme, "Am Brunnen vor dem Tore" oder "Es liegt eine Krone im grünen Rhein". Witze oder schlüpfrige Anekdoten kannten wir gar nicht; uns umgab eine geistige, fast aristokratische Atmosphäre, die uns zu eigener Kreativität anregte. Langeweile kannten wir nicht. Wir wurden auch zu sozialem Verhalten erzogen. - Daß wir bei unseren Reisen in die väterliche Heimat die bäuerlichen Verwandten respektierten, war selbstverständlich. So waren auch die politischen Ansichten der Eltern nicht konservativ-national. Sie engagierten sich beide in der Deutschen Volkspartei, die damals von Stresemann geführt wurde. Lange vor 1933 war mein Vater ein leidenschaftlicher Hitlergegner und mußte später berufliche Nachteile in Kauf nehmen. [s. Brief des Amtes für Erzieher] Wir Kinder haben es damals an Zuwendung, Liebe und Dankbarkeit fehlen lassen; jedenfalls muß ich das von mir sagen. Wir hatten schon alle Fünf unsere eigenen Probleme, vor allem unsere eigenen Kinder, denen unsere ganze Liebe und Fürsorge galt. Das mag auch anderen Eltern so gehen. Der Dichter Börries von Münchhausen hat es in einem schönen Gedicht zum Ausdruck gebracht. Erlaubt mir, daß ich es zum Schluß vorlese. Der goldene Ball. Nun wächst ein Sohn mir auf, so heiß geliebt Denn wenn er Mann ist und wie Männer denkt, Weithin im Saal der Zeiten sieht mein Blick Es war mein Wunsch, heute vor Kindern und Enkeln eine alte Dankesschuld, wenn auch verspätet, abzutragen.
|
|